Mehr Maker, weniger User!
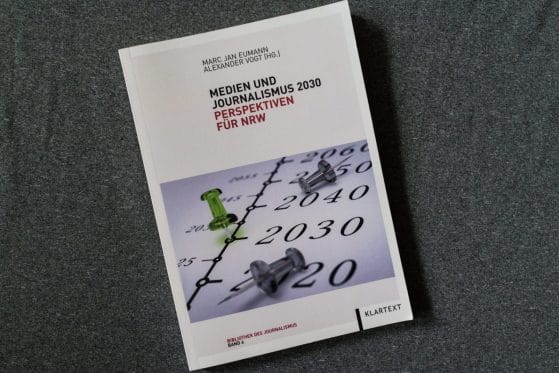
Die Ursprungsfassung erschien im Mai 2017 in dem Sammelband Marc Jan Eumann (Herausgeber), Alexander Vogt (Herausgeber): Medien und Journalismus 2030 „Medien und Journalismus 2030 – Perspektiven für NRW“ im Klartext-Verlag.
Die Debattenräume einer Gesellschaft formen ihre Debatten. Winston Churchill formuliert das im Oktober 1943 vor dem britischen Unterhaus einprägsam:
„We shape our buildings and afterwards our buildings shape us.“ (House of Commons, cc 403)
Damals geht es um den Neubau des von deutschen Bomben zerstörten Unterhausgebäudes. Churchills klare Präferenzen: Der neue Parlamentssaal soll rechteckig und zu klein für alle Abgeordneten sein. Rechteckig, damit Regierungsfraktion und Opposition im klaren Antagonismus einander gegenübersitzen statt im Halbrund nebeneinander. Dass es bei einem vollen Haus nicht genügend Sitzplätze für alle Abgeordneten geben soll, begründet Churchill so: Wenn einmal wirklich alle Abgeordneten zugleich anwesend sind, gehe es um Debatte von großer historischer Bedeutung, dann soll man das am Gedränge spüren. Und, ebenso wichtig: Im Parlamentsalltag sei lebhafter Austausch essentiell, das gehe in einem halbleeren Raum schlecht.
Die Gebäude der digitalen Sphäre formen heute unsere öffentlichen und halböffentlichen Debatten. Hier geht private fließend in öffentliche Kommunikation über. Die Diskussionen in sozialen Medien wirken auf alle dort Aktiven: Bürger, klassische Redaktion-to-many-Medien, Politik, den dritten Sektor. Unabhängige und vielfältige Medien sind Grundpfeiler einer lebendigen und funktionierenden Demokratie – das beinhaltet selbstverständlich alle digitalen Diskursräume. Das sind entscheidende Fragen für Medienpolitik: Wie vielfältig sind die Debattenräume der digitalen Sphäre? Wie formen sie Öffentlichkeit?
Wenn es gut läuft, wird es im Medienland 2030 vielfältige Debattenräume in der digitalen Sphäre geben. Neue digitale Räume werden auch auf lokaler und regionaler Ebene gestaltet, viele von kompetenten, engagierten Nutzern, Vereinen, dem öffentlichen und dem dritten Sektor und von lokalen Medienhäusern.
Warum diese Medienvielfalt in der digitalen Sphäre nötig ist, zeigen einige Schlaglichter aus der empirischen Forschung über die wenigen heute dominierenden Plattformen:
- Emotional aufgeladene Nachrichten werden häufiger per Retweet weiterverbreitet als neutrale. Bei negativ aufgeladenen ist der Effekt stärker, ergab eine Analyse von 17.788 Tweets im Umfeld zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 2011 (Stieglitz & Dang-Xuan, 2013).
- Negativ emotional aufgeladene Tweets verbreiten sich deutlich schneller als positive oder neutrale. Positiv Texte werden weit häufiger favorisiert, ergab eine Analyse aller 19,7 Millionen im September 2014 veröffentlichten Tweets ohne Fotos oder Videos (Ferrara & Yang 2015).
- Negative Beitrage auf den Facebook-Seiten politischer Parteien erhalten mehr Kommentare als positive, ergab eine Analyse von 5626 Beiträgen auf den offiziellen, bundesweit ausgerichteten Facebook-Seiten deutscher Parteien zwischen März und September 2011 (Stieglitz & Dang-Xuan, 2012)
- Wem Facebook mehr negative Beiträge zeigt, der schreibt bei Facebook selbst in Folge messbar negativer. Wer mehr Positives sieht, messbar positiver. Das ergab ein von Facebook Anfang 2012 mit 689.003 Mitgliedern durchgeführtes Experiment (Kramer et al., 2014).
Solche Effekte beeinflussen den gesellschaftlichen Diskurs insgesamt. Drei naheliegende Effekte:
- Digitale Medien verstecken publizistische Entscheidungen: Firmen wie Facebook verteilen als Medienunternehmen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Sie stellen sich jedoch als neutrale Technologieanbieter dar. So entziehen sie sich intern wie extern der Debatte darüber, welcher publizistischen Linie ihre Medien folgen. Es ist eine publizistische Entscheidung, welche Beiträge wie viel Aufmerksamkeit erhalten kann. Der kommerzielle Erfolg werbefinanzierter Plattformen steigt, je mehr Aufmerksamkeit sie binden. Warum sollten nicht Beiträge prominenter ausgespielt werden, die stärker mobilisieren und kurzfristig messbare Reaktionen provozieren als andere? Wenn sich emotionale Äußerungen hochschaukeln, kann das als Erfolg gelten, sofern der Erfolg an der so gewonnenen Aufmerksamkeit gemessen wird. Und das ist wahrscheinlich, wenn die Medien nicht andere Normen entwickeln.
- Wirkung auf redaktionelle Medien: Was gut klickt, kann nicht ganz verkehrt sein – alle Medien wollen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das könnte eine Erklärung für den medialen Erfolg der Empörungs- und Unterhaltungsmaximierer wie Trump sein. Wenn jede menschenverachtende Äußerung und jeder bizarre Auftritt zu Aufmacherplätzen bei Onlinemedien führt, setzt das einen starken Anreiz. Wie Sascha Lobo schreibt: „Die politische Öffentlichkeit wird genau durch diese Grenzverschiebungen zum immer schriller kreischenden Stammtisch, begünstigt durch die sozialen Medien, befeuert aber auch von redaktionellen Medien, die sich selbst in einen Sharing-Teufelskreis hineinsteigern: je schriller, desto like.“ (Lobo, 2016)
- Chancen für gesellschaftliche Teilhabe: Der Zugang zum Netz und eine gewisse Kompetenz in der Bedienung gängiger Benutzeroberflächen sind eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für mehr gesellschaftliche Teilhabe. Es kommt darauf an, wer welche Werkzeuge und Plattformen wofür nutzt. Wie Christopher Lauer bilanziert: „Die dominierenden sozialen Medienplattformen eignen sich hervorragend zur Mobilisierung, zur Gruppenbildung und zur blitzartigen Informationsverbreitung – aber nicht zur produktiven, politischen Diskussion; deshalb müssen diese Debattenräume völlig anders strukturiert werden als Twitter oder Facebook, es braucht eigene, funktionierende Plattformen für die digitale Demokratie.“ (Lobo & Lauer, 2014, Loc 2485-2487)
Unterschiedliche soziale Medien formen die Öffentlichkeit verschieden. So produktiv die Arbeit an politischen Programmen mit einem Werkzeug wie Liquid Feedback sein kann, so konstruktiv Diskussionen in Foren wie Metafilter oder Quora laufen – es gibt viele andere Beispiele mit anderer Ausrichtung, Moderation und daraus resultierender Öffentlichkeit. Deshalb gilt für die Medien der digitalen Sphäre dasselbe wie für ausschließlich redaktionell gepflegte Angebote: Die Vielfalt ist der Grundpfeiler einer lebendigen und funktionierenden Demokratie.
Das Kernversprechen des Internets ist dieses: mehr Vielfalt und mehr Teilhabe durch leichten Zugang, Dezentralität und Selbstorganisation. Das war den Idealen der Entwickler geschuldet, die die grundlegenden Protokolle und Standards des Netzes entwickelt hatten. Die heutige Mediennutzung ist nicht mehr maßgeblich von Vielfalt und Autonomie beeinflusst, wie jeder Blick auf die Trafficquellen großer Digitalmedien beweist. Die schwarzen Löcher im Netz, die alle Aufmerksamkeit und alle Inhalte anziehen, aber wenig nach außen dringen lassen, folgen stets einer klaren Agenda: So viel Reichweite wie möglich erzielen, um sie an Werbekunden zu vermarkten.
Medienvielfalt ist nicht naturgegeben, sie gedeiht im richtigen Rahmen. Es braucht auch in der digitalen Sphäre Vielfaltssicherung. Und die Medien im Sinne der gesellschaftlich erwünschten Medienvielfalt sind heute nicht ausschließlich redaktionell gepflegte Medien. Nötig sind Code und Kompetenz für ein vielfältiges Netz. Ideen:
- Freie digitale Werkzeuge für ehrenamtliches Engagement. Überall, wo sich Menschen in ihrem Quartier engagieren, kann freie Software vieles zugänglicher, einfacher und effizienter machen. Ein richtig auf die Prozesse abgestimmtes Ticketing-System, ein mit Discourse aufgesetztes Diskussionsforum, ein offener Team-Chat wie Mattermost schlagen jede Whatsapp-Gruppe, wenn es beispielsweise um die Organisation von Flüchtlingshilfe geht. Jede ehrenamtliche Initiative und jeder Verein im Land sind kleine soziale Gemeinschaften mit ganz konkreten Anliegen, bei denen Software helfen kann. Für diesen Einsatz braucht es ein Paket aus Training, Hosting und Anpassung der Software. Das ist Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements und der Plattformen für die digitale Demokratie.
- Digitale soziale Kompetenz fördern. Gute Moderation sichert ein gutes Miteinander in jeder Gruppe, jedem Forum, jedem digitalen Kanal. Software hilft, klare Regeln auch, aber ein guter Moderator braucht Erfahrung, Training und kollegiale Beratung. Schulungen (online und offline), ein Forum für Beratung und Technikkompetenzförderung für alle Ehrenamtlicher, die auch moderieren müssen, legen die Grundlage für einen konstruktiven gesellschaftlichen Diskurs.
- Offene Software und offene Plattformen für die Exekutive. Wo die Verwaltung digital mit Bürgern kommuniziert, muss jede Anstrengung, die in geschlossenen Plattformen investiert wird, auch einem neutralen, öffentlichen Raum zugutekommen. Konkret: Wenn ein Bürger Kontakt zu staatlichen Stellen sucht oder aktuellen Informationen folgen will, muss er die Wahl haben zwischen den dominierenden sozialen Medienplattformen und einer öffentlichen, nicht-kommerziellen, datensparsamen Alternative, zum Beispiel nach dem POSSE-Prinzip: Publish (on your) Own Site, Syndicate Elsewhere. Staatliche Stellen müssen Daten in nicht-kommerzielle, der Öffentlichkeit dienende digitale Institutionen wie Wikidata, Openstreetmap, Wikimedia Commons übertragen. Um die Vielfalt in der Softwareentwicklung zu fördern, ist freie Software zu nutzen und zu fördern – etwa durch Security Audits, wie es die Europäische Kommission und das Parlament im EU-FOSSA-Projekt vormachen.
- Der kreativen, dem Gemeinwohl dienenden Umgang mit digitaler Technik fördern. Damit mehr Menschen, die digitale Sphäre mitgestalten, müssen mehr Menschen Erfahrungen sammeln, wie kreativ man mit digitaler Technik sein kann. In Makerlabs, in Hackerspaces, im Freifunk und Gedächtnisinstitutionen. Ein Programm für Wikipedians in Residence in Archiven, Bibliotheken und vergleichbaren Einrichtungen könnte ein Anfang sein, um Kulturgüter digital zugänglich machen und so Teilhabe zu sichern. Eine ideale Erweiterung wäre ein Projekt für Heimatvereine, Schulen und Volkshochschulen, das die Arbeit am Mitmach-Lexikon lehrt, fördert und vor allem am konkreten Beispiel mit den Wikipedians in Residence übt.
„The Net is of us, by us, and for us“, heißt es in der Neuauflage des Cluetrain Manifests (Searls & Weinberger, 2015). So sollte es sein, im Medienland 2030 - das wir steht für breite, aktive gesellschaftliche Teilhabe. Für Medienvielfalt in der digitalen Sphäre brauchen es mehr Maker, weniger User.
Literatur
Ferrara, E., & Yang, Z. Z. (2015). Quantifying the effect of sentiment on information diffusion in social media. PeerJ Computer Science, 1, e26. http://doi.org/10.7717/peerj-cs.26
House of Commons (1943). Sitting of 28 October 1943, vol 393 cc403-73, http://hansard.millbanksystems.com/commons/1943/oct/28/house-of-commons-rebuilding. Abgerufen am 4.9.2016, archiviert mit WebCite: http://www.webcitation.org/6kGbFOqqF
Kramer, A. D. I., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(24), 8788–8790. http://doi.org/10.1073/pnas.1320040111
Lobo, S. (2016, 2. Februar). Wir schlittern in die Schreispirale. Spiegel Online. http://www.spiegel.de/netzwelt/web/sascha-lobo-zu-donald-trump-wir-schlittern-in-die-schreispirale-a-1076632.html. Abgerufen am 4.9.2016, archiviert mit WebCite: http://www.webcitation.org/6kGwzDagY
Lobo, S., & Lauer, C. (2014). Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei. [Kindle-Ausgabe].
Searls, D., & Weinberger, D. (2015, Januar 8). New Clues. von http://newclues.cluetrain.com/ Abgerufen am 10. September 2016, archiviert mit WebCite: http://www.webcitation.org/6kQBhzNUm
Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2012). Impact and Diffusion of Sentiment in Political Communication — An Empirical Analysis of Public Political Facebook Pages. In ECIS 2012 Proceedings (pp. 5–15). Retrieved from http://aisel.aisnet.org/ecis2012/98
Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2013). Emotions and Information Diffusion in Social Media—Sentiment of Microblogs and Sharing Behavior. Journal of Management Information Systems, 29(4), 217–248. http://doi.org/10.2753/MIS0742-1222290408